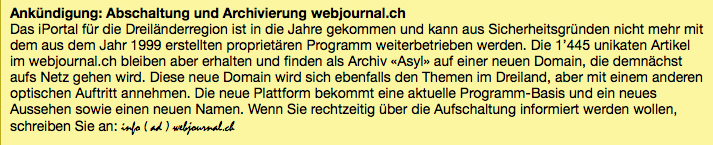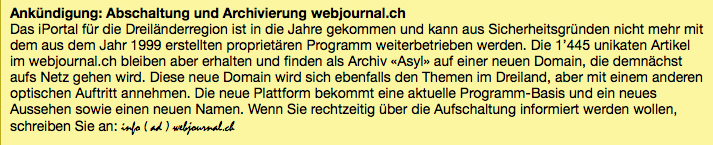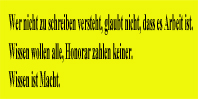|
Theater Basel
Korrigenda: Rolf Romei singt den Andrei
Basler Theater eröffnet grossartig mit «Chowanschtschina»
Eine echt grosse Kiste mit Massenszenen, lebensechten Bahnhof-Kulissen, aber voller Poesie trotz beklemmend aktuellem Bezug - Oper vom Feinsten
Von Jürg-Peter Lienhard

Vladimir Matorin (rechts) als Chowanski, der Anführer der Strelitzen. Gossartiger Bass und auch glaubhaft als Schauspieler. Foto Simon Hallström zVg
Nach einer wundervollen Ouvertüre, die das Morgenrot am Moskwa-Fluss heraufzaubert, könnte das erste Bild der Oper «Chowanschtschina» nicht verstörender wirken. Und kaum treten die ersten Protagonisten auf, wird ganz schnell klar, worum es geht: Um einen Machtkampf, den brutale Anführer sich anschicken, für sich zu entscheiden - auf Kosten des Volkes. In dem grossen historischen Drama von Modest Petrovitch Mussorgski aus den späten 1870-er Jahren gibt es somit jede Menge Bezüge zur Gegenwart, zum Flüchtlingsdrama, zum Ukraine-Konflikt, aber auch zur Liebe. Und eine Pointe dabei ist, dass der Regisseur Russe und der Dirigent Ukrainer ist. Vorweg aber: eine begeisternde Leistung des ganzen Ensembles, zumal in russischer Sprache gesungen wird. Für mehr hier klicken:
Das Bühnenbild. Im ersten der fünf Akte wird der Tarif der Inszenierung durchgegeben: Wohl ein kriegsversehrter Bahnhof. Ein echter Güterwagen steht auf den beiden Geleisen, die offenbar kurz zuvor Kriegsschauplatz waren. Zivile Opfer liegen herum, und deren Kadaver werden von Milizen mit respektlosem Schwung in den Güterwagen geschmissen. Keine Puppen, sondern Chor-Mitglieder. Links und rechts der Geleise verbinden hohe Treppen die Perrons: Man kann sich unschwer die Treppenaufgänge zu der Passerelle im Basler Bahnhof SBB vorstellen (Bühnenbild: Zinovy Margolin). Doch, was hier Theater ist, findet sich auf Youtube massenweise und echt: Per Handy aufgenommene Greueltaten an Zivilisten und an Kriegsgefangenen, an die das Theater selbst in «lebensechter» Bühnendarstellung nie hinreicht. Zum Glück für das Basler Publikum.
Die Opernsprache. Die Oper wird auf Russisch gesungen, was eine Herausforderung auch für den grossen Extrachor unter der Leitung von Henryk Polus war, der auch an der Einführungs-Matinee vom Sonntag vor der Premiere kräftig solistisch mitsang. Auf Russisch, wohlverstanden, schliesslich war Russisch für den Polen früher in der Schule Pflichtfach. In dieser Matinee, die Pavel B. Jiracek als Dramaturg charmant moderierte, bekamen die ausserordentlich zahlreichen (und zahlenden) Teilnehmer an der Kasse ein Notenblatt, um den gewaltigen Schluss-Chor mitzusingen. Um das Publikum mit der nicht ganz einfachen Notation und dem russischen Text etwas beizustehen, kreiste der Extrachor die Matinee-Zuschauer ein und sang vor. Dabei übertönten sie spielend Misstöne, vermittelten aber eine ausgezeichnet aufgenommene Probe des bevorstehenden Hörereignisses. Die Bässe, die gewaltige Schwermut der Musik, jedenfalls vereinnahmten und bliesen das Publikum beinahe um.

Jodanka Milkova als Marfa und Rolf Romei als Andrei Chowanski. Foto Simon Hallström zVg
Die Musik. Von der Musik Mussorgski gibt es wegen seines Todes im März 1881 nebst dem Text nur einen Klavierauszug. Verschiedene Komponisten nahmen sich danach der Komposition an um sie zu vervollständigen: Rimsky-Korsakow, Diaghilew, Strawinsky und Schostakowitsch. In Basel wird die Version von Schostakowitch mit dem Schluss von Strawinsky verwendet, die 1960 im damaligen Leningrad aufgeführt und seither verwendet wird. Mussorgskis «Boris Godunow» ist zwar weit populärer und sehr viel mehr gespielt, auch wenn sie ebenso wie Chowanschtschina ein geschichtlich komplexes Thema behandelt. Zurzeit wird Chowanschtschina aber auch in Wien von der Staatsoper aufgeführt.
An der Einführungs-Matinee hatte der neue Intendant des Basler Theaters, Andreas Beck, darauf verwiesen, dass so eine «grosse Opernkiste» mit einem derart grossen Aufgebot an Mitwirkenden, eben Jahre zuvor aufgegleist werden muss. Dass die Gegenwart die Aufführung nun voll in die lokale und internationale Aktualität katapultiert hat, sei allerdings nicht mal vor einem Jahr vorhersehbar gewesen.
Der Inhalt. Der Text (kann mit untenstehendem Link im Format PDF heruntergeladen werden) ist komplex, die Handlung noch komplexer und wirkt zum Lesen harzig - was natürlich auch an der Übersetzung liegen kann. Doch nach wenigen Dialogen wird schnell mal klar, dass er auf die Darstellung der Mechanismen eines Machtkampfes zusteuert. Dabei ist die Geschichte schnell erzählt, trotz der vielen Dialoge und der vielen handelnden Personen. Und wie es sich für Oper gehört, ist auch eine Liebesgeschichte dabei, die höchst tragisch endet. Das Stück spielt im 17. Jahrhundert in Russland, zur Zeit, als der spätere Zar Peter der Grosse noch minderjährig war, weshalb sich zwei Fürsten an seiner Statt um die Ausübung der Macht brutal stritten.
Die Protagonisten agieren mit Lug und Trug, List, Verrat und Intriganz, aber stets mit roher Gewalt, bei der das Volks nicht verschont wird. Dieses steht sowieso unter der «übergeordneten» Fuchtel des Glaubens, womit die Herrschenden ein mächtiges Mittel in den Händen halten, weil sie sich darauf stützen, dass sie von der Kirche, also von Gott, zum Herrschen ausgewählt sind. Nicht verwunderlich, dass ausgerechnet der Russe Lenin den deutschen Philosophen Marx zitierte, dass «Religion Opium für das Volks» ist - Glaube gegen Vernunft, Glaube gegen Freiheit, Glaube gegen Wissen, zumal Wissen um die Mechanismen und die Gefahren der Macht. Auf jeden Fall mischt der Pope als «gütiger Vater» aktiv im Machtpoker mit.

Alle russischen Bässe müssen aussehen wie Ivan Rebroff und Bass aus tiefster Seele singen. Dies hier ist aber der Star der Inszenierung «Chowanschtschina» am Basler Theater und hat noch einige Zacken mehr drauf als Hans Rudolf Rippert. Foto Simon Hallström zVg
Die Pole. Wie heute, war das damalige Russland gespalten, was das eigene Selbstverständnis betrifft: Es gab eine Tendenz zum «Altgläubigen» und eine eher europäisch ausgerichtete. Pole waren die griechisch-orhtodoxe Ausrichtung und die russisch-orthodoxe sowie die aus Deutschland stammenden Einflüsse der lutherianischen Reformation. In Mussorgskis Text ist denn auch die von den Kriegsfürsten zur Waise gemachte Emma als «Lutherianerin» die rechtlose, die, weil besonders jung und hübsch, von den Oligarchen als sexuelles Freiwild begehrt wird.
Die Aufführung. Auch im Theater Basel ist jetzt Multimedia angekommen und setzt damit ein zusätzliches Stilmittel in Szene: Nach jedem Akt fährt eine Leinwand von immensem Ausmass des gesamten Bühnenrahmens herunter, worauf zum Bühnenbild korrelierende Videosequenzen mit winterlichen Geleiselandschaften, wohl von der Sibirischen Eisenbahn, ablaufen und damit die Wartezeit der Bühnenbild-Umbauten ausfüllen. Die schwarzweiss gehaltenen Aufnahmen im Schnee lassen buchstäblich frösteln. Mit der Ouvertüre erscheinen in Abständen Schriftzüge, die die Entfernung «zur Hauptstadt» anzeigen, und gleichzeitig zeigt das Video den jeweiligen Bahnhof. Beginnend bei Altstätten ZH und wohl endend bei Wladiwostok bei Kilometer 15’000. Damit scheint die Regie beabsichtigt zu haben, durch die in Tausenderschritten eingeblendeten Distanzen und der gefilmten menschenleeren Landschaften eine Ahnung des russischen Raumes zu vermitteln. Schade nur, dass der Zuhörer bei der wunderschönen Ouvertüre durch die Aufnahmen vorbeiflitzender Züge am Hörgenuss abgelenkt wird. Bewegte Videobilder zu Musik sind sowieso höchst problematisch!
Indessen glänzt die Aufführung durch perfekt abgestimmte Details, manchmal kaum wahrnehmbar, weil man sich auf die Protagonisten konzentriert. Aber in der Summe machen diese Details ein Bild, das lebt, das höchst lebendig ist, wie die bevölkerte Bahnhofs-Passerelle. Dabei gelang es dem Regisseur Vasily Barkhatov, der sich am Theater radebrechend englisch abmühen muss, gleichwohl jedes dieser Details fugenlos ins Gesamtmosaik einzufügen. Eine unglaubliche Leistung eines erst 32-jährigen Regisseurs, dem die Bewältigung dieser derart grossen Kiste auf Anhieb gelang. Natürlich hatte er mit den Sängern keine Sprachprobleme, da diese alles Russen sind. Chorleiter Henryk Polus jedenfalls brauchte für die Einstudierung des Extrachores fast zwei Jahre (abzüglich Ferienzeit), weil die hiesigen Mitglieder nicht russischer Sprache sind, und weil Russisch für deutsche Zungen eben nicht ganz einfach ist. («Chowanschtschina» fehlerfrei zu tippen, gelingt mir auf Anhieb immer noch nicht…).
Barkhatov hat es trotz der «Wimmelbilder» verstanden, den Fokus auf die entscheidenden Handlungs- oder Brennpunkte zu leiten. Und immer wieder blitzt Ironie auf, trotz sehr realistisch umgesetzter Bilder: So küssen die Altgläubigen einen Aktenkoffer statt einer Ikone. Und dieser Aktenkoffer ist erst noch mit einer Sicherungs-Handschelle versehen, so wie die Geld- oder Geheimnisträger sich damit vor einem Entreissdiebstahl absichern. Erst am Schluss wird verraten, was in diesem geheimnisvollen Koffer ist: Das Gift, das für den gemeinsamen Suizid der Aufständischen, aber vor allem für Marfa, die ihren Andrei mit in den Selbstmord nimmt. Übrigens dargereicht vom Popen…
Barkhatovs Imagination gibt selbst dort Szenen Schwung, und damit auch Verständnis, wo der Schwerpunkt auf dem Dialog liegt. Dann entsorgt der Fürst Golizyn sein Manuskript nicht im Papierkorb, sondern in der Holzkohle des Wurstgrills eines Schützenstandes. Und gleichwohl macht er mit seinen Einfällen gerade in diesem Dialog sichtbar, wie die Kontrahenten um die Macht gleichauf versuchen, den anderen auszubooten: Wie in einem Western richten die Fürsten Golizyn und Chowanski vor einem scheinheiligen Aufschneider-Geplänkel unvermittelt gleichzeitig ihre Waffen gegeneinander - patt…

Pavel Yankowsky als der Intrigant Schaklowity. Foto Simon Hallström zVg
Stichwort «Western». Tatsächlich hat man bei dieser rundum grossartig gelungenen Inszenierung den Eindruck von grossem Kino, auf jeden Fall von grossem Theater: Breitleinwand, Landschaft, Dramatik. Und selbst die Musik Schostakowitschs hat stellenweise etwas von Hollywood, zumal die Soldatesken mit viel Pauken und Trompeten untermalt werden. Regisseur Vasily Barkhatov hat dabei aus dem Vollen geschöpft und lässt dem Zuschauer grossen Spielraum bei der Interpretation und verneint auch nicht das politische Assoziations-Potential. Aber ihm ging es doch hauptsächlich um einen besonderen Aspekt, der vielleicht bei dem enorm komplexen Thema beinahe untergehen mag: Um die Tragik und das Schicksal einer einzigen Figur. Nämlich von Marfa - gespielt von der hochgewachsenen Jordanka Milkova. Ihr scheint die Rolle geradezu auf den schlanken Leib geschnitten zu sein, kann sie doch mit ihren tiefdunklen Augen und dem auch im Text als «schlangehaft» bezeichneten Auftreten, genau die Person darstellen, die dem Regisseur als «Leitmotiv» des Stücks wichtig war: Die zur Fiktion gewordene enttäuschte Liebe zu Chowanskis Sohn Andrei treibt sie unvermeidlich bis in den Tod. So wie Hass blind macht, hat die enttäuschte Liebe Marfas Denken, Fühlen und Handeln besessen gemacht.
Diese Besessenheit ist bereits beim ersten Auftreten Marfas dabei und zieht sich durch die folgenden Szenen, wird aber erst mit dem tragischen Ende in seiner Unerbittlichkeit voll erfassbar. Ein Aha zum Schluss: Mitten im intriganten Machtkampf der männlichen Protagonisten läuft ein zweites Drama mit, dessen Motiv nicht Macht, sondern Ego ist. Für Regisseur Barkhatov «sein» Leitmotiv für die Inszenierung, das über den aktuellen Bezügen steht.
Die Protagonisten des Machtkampfes sind schon physisch und stimmlich adäquat besetzt: Der Titelgeber Chowanski, dargestellt von Vladimir Matorin, wirkt nicht nur wegen seines Umfangs wie «Ubu Roi», sondern ist auch eine ironisch gemeinte Darstellung eines Autokraten. Sein Bass ist genau das, was man von einem russischen Bass erwartet. In seiner beinahe karikaturenhaften kriegerischen Aufmachung bedient er zwar ein Cliché des russischen Haudegens. Aber sein Bassgesang und sein schauspielerisches Handeln hat ihm dann auch an der Premiere den meisten Applaus gegeben. Sein Sohn Andrei (Rolf Romei) stellt sich ihm rebellisch entgegen. Und Pavel Yankovisky singt den Intriganten Schaklowity mit tiefster Inbrunst - trotz abklingender Erkältung. Er singt eine Arie, die, wenn man kein Russisch versteht, einem hörbar erahnen lässt, was unter der Vorstellung von «die russische Seele» verstanden werden kann. Ebenso eindrücklich und gefeiert wurde Dmitry Ulianov als Pope Dossifei, Karl-Heinz Brandt als Schreiber, Betsy Horne als Emma und andere.
Die Musik. Das Sinfonieorchester Basel dirigierte der Ukrainer Kirill Karabits. Die enorme Zahl der Mitwirkenden auf der Bühne und im Orchestergraben war eine grosse Herausforderung, die ihm souverän gelungen ist. Er sah sich vor die Aufgabe gestellt, Mussorgskis Intentionen aufgrund dessen Klavierauszug mit der Version Schostakowitschs Orchester-Version unter einen Hut zu bringen. Während Schostakowitsch sowieso bei den Soldateska-Stellen mit viel Lautstärke komponiert hat, hat Mussorgski schon in seinem Klavierauszug viele «feine» Stellen vorgesehen. Gleichwohl beginnt die Ouvertüre sehr zart und spiegelt die Stimmung eines aufkommenden Morgens wider. Für Karabits ist dieser Morgenrot-Sonnenaufgang beinahe programmatisch für Russland: Nach den Wirren der Vergangenheit träumten die Menschen jeweils sehnsüchtig vom Aufbruch in eine neuen Zukunft.

An der Premierenfeier im Foyer des grossen Hauses bitten Theaterdirektor Andreas Beck und Opernleiterin Laura Berman auch die Mitwirkenden von hinter der Bühne zum Applaus auf die Foyer-Treppe. © foto@jplienhard.ch ab iPhone
Die Premiere. Man hat dem Saisonstart unter der neuen Direktion von Andreas Beck mit grosser Spannung entgegengesehen. Beck selbst ist eher im Schauspiel daheim, weswegen die Eröffnung mit einer Oper und erst noch mit buchstäblich «grossem Kino» hohe Erwartungen, wenn nicht gar Skepsis erzeugten. Wenn bei einer Aufführung etwas schief läuft, dann ist es oft an der Premiere, wo die Mitwirkenden unter angespanntem Stress stehen. Der Theaterdirektor trat dann gleich vor Beginn der Oper vor den roten Vorhang, und es schwante einem nichts Gutes. Tatsächlich verkündete Andreas Beck, dass zwei Sänger unter einer auslaufenden Erkältung litten, es aber unbedingt gleichwohl wagen wollen, an dieser Premiere mitzusingen. Für so viel Loyalitätswillen spendete dann das Publikum einen Voraus-Beifall, der wohl heilsam für die Sänger war. Denn erkältungsbedingte Krächzer blieben nicht wahrnehmbar. Auf jeden Fall war dann der Schlussapplaus überwältigend. Er galt allen Mitwirkenden, worunter man es Regie und Dirigent förmlich ansah, dass sie erleichtert waren und sich dann entspannt der allgemeinen Freude hingaben. Das Publikum war wohl erstaunt über das unerwartet erfolgreiche Resultat, über das Stück, über die Grösse der Kiste, über das Dargebotene ebenso wie es wohl auch Ansporn zum Besuch von kommenden weiteren Produktionen unter dem neuen Intendanten zu nehmen gewillt sein dürfte.
Das Haus. Das Theater Basel musste wegen Ungenügens einer an der Sanierung beteiligten Firma den Saisonstart um gut einen Monat hinausziehen. An einem Rundgang hinter den Kulissen wurde den Pressevertretern gezeigt, wo die rund 72 Millionen Franken für die Sanierung eingebaut sind: Nebst Erweiterung der WC-Anlagen, insbesondere bei den Frauen, wurde der Schnürboden mit neuen Maschinen und Sicherheitseinrichtungen renoviert. Grösster Brocken der Sanierungskosten sind jedoch der Einbau einer neuen und effizienten Heizung/Lüftung. Aber allein für das Publikum sichtbar ist die neue Bestuhlung und die neuen Sitzbezüge. Eine Kommission von Experten hat sich für sogenannte Schwingstühle entschieden, die den Sitzkomfort merklich erhöhen. Dann wurde im Zuschauerraum der Boden und die stufenförmigen Reihen erneuert, was zwischen den Sitzreihen mehr Beinfreiheit ergibt. Jeder der mit diskretem Grau drapierten Stühle verfügt über eigene Armlehnen, so dass man mit den Ellenbogen der Nachbarn nicht mehr in Konflikt gerät. Durch die Erhöhung des Komforts verringert sich die Platzanzahl von bisher um die 1’000 auf noch 850 Sitze im Parkett sowie zehn freie Plätze für Rollstühle (in bester Kategorie). Zudem ist ein Mittelgang zwischen den Parkettreihen eingebaut worden, womit nun das Aufsuchen eines Sitzplatzes durch weniger lange Reihen erleichtert wird. Die vor der Bühne angeordneten sechs Reihen können sehr leicht entfernt werden, um flexibel auf Ansprüche von Orchester oder Regiekonzept zu sein. Ja, diese Reihen können um 180 Grad gedreht und auf die Bühne gestellt werden, so dass eine Arena entsteht.
Schon nur weil die Renovation dem Publikum einige Vorteile gebracht hat, lohnt sich in der kommenden Saison ein Besuch des Theaters, zumal auch auf der grossen Bühne auch Schauspiel vorgesehen ist. Die Oper «Chowanschtschina» ist jedenfalls eine glänzende Idee für einen Besuch im Basler Theater. Einer der Rhetorik-Grundsätze lautet: Das Zweitbeste am Anfang, das Beste am Schluss. Wenn das Basler Theater dieser Regel folgt, dann dürften wir höchst gespannt sein, was dann zumindest am Schluss der ersten Saison auf das Publikum wartet…
Von Jürg-Peter Lienhard
Für weitere Informationen klicken Sie hier:
• Direktlink zum Theater Basel - Spielplan
• Text derStuttgarter Aufführung im Format PDF
|